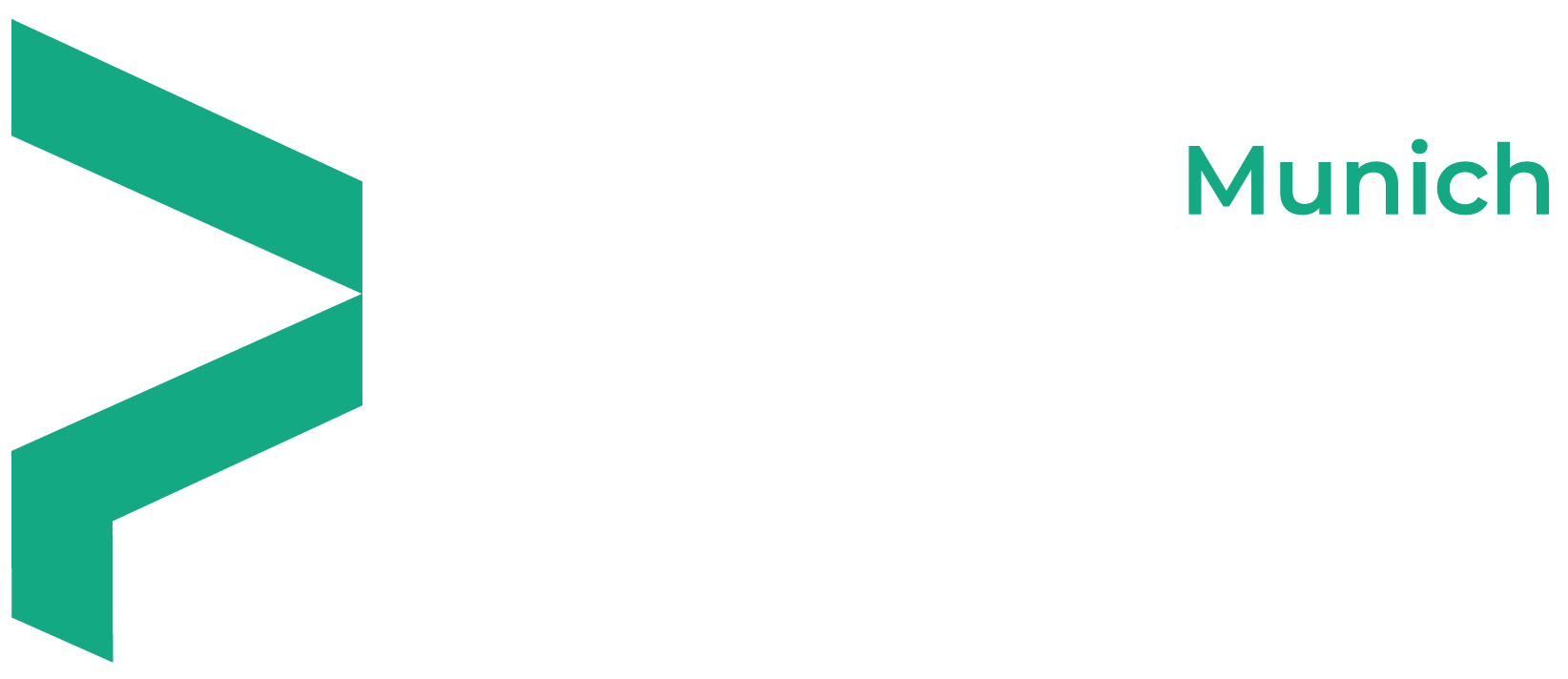Lokales Colocation-Rechenzentrum perfekt für Ihr Unternehmen
Portus Data Center MUNICH
Das Portus Data Center Munich ist Teil der breiteren Portus Data Centers Group, die seit 2020 trägerneutrale Edge-Colocation-Dienste in ganz Deutschland und den umliegenden Regionen anbietet.
Wir haben eine vielfältige Kundenbasis, darunter Telekommunikationsanbieter, IT-Dienstleister, globale Technologie- und Social-Media-Unternehmen, Content-Distribution-Netzwerke sowie Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die alle ihre IT-Infrastruktur an einem sicheren Ort in der Nähe ihrer eigenen kritischen Betriebsstätten hosten möchten.

„Navigation von Arbeitslasten: Ansatz des Unternehmens bei öffentlichen, hybriden und privaten Clouds.“
Adriaan Oosthoek, Chairman Portus Data Centers
Über Colocation
Wir bieten unseren Kunden Rechenzentrumskapazitäten und digitale Infrastrukturdienste, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
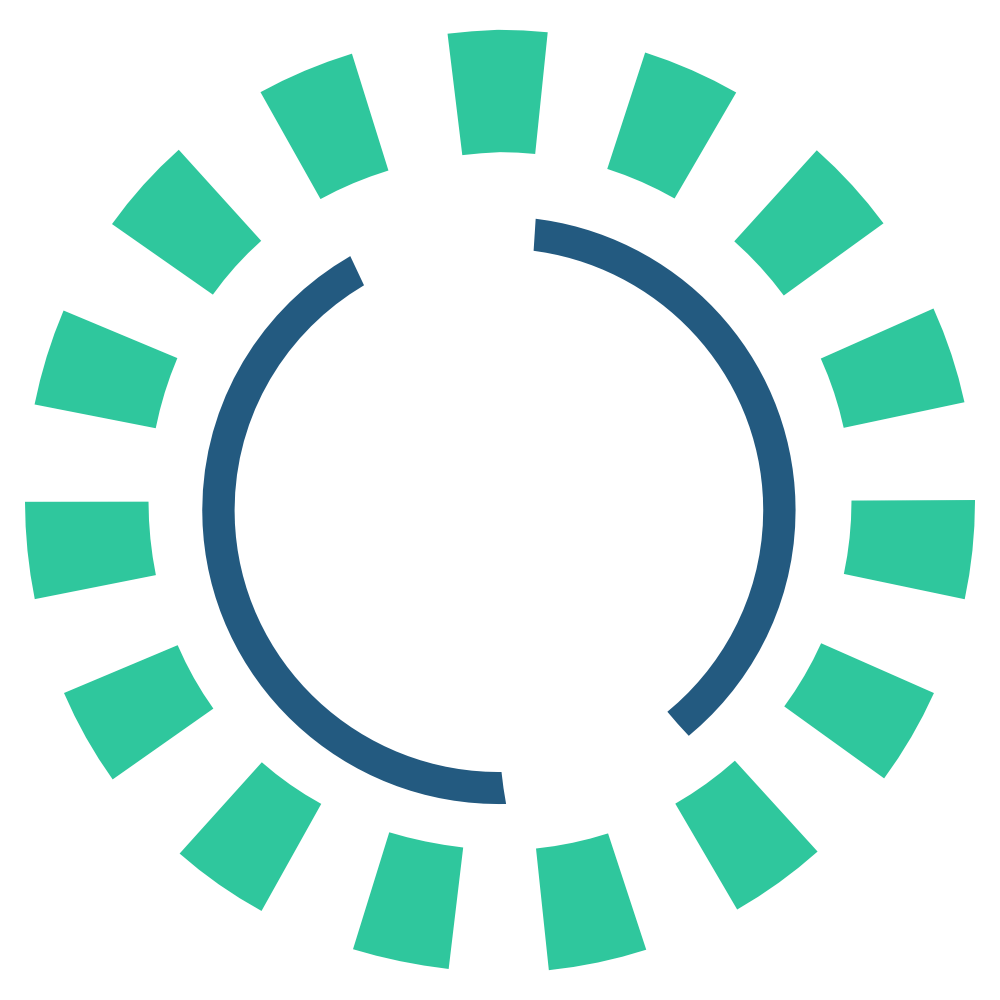
Carrierneutrale Colocation

Edge-Rechenzentren

Netzwerk-konnektivität
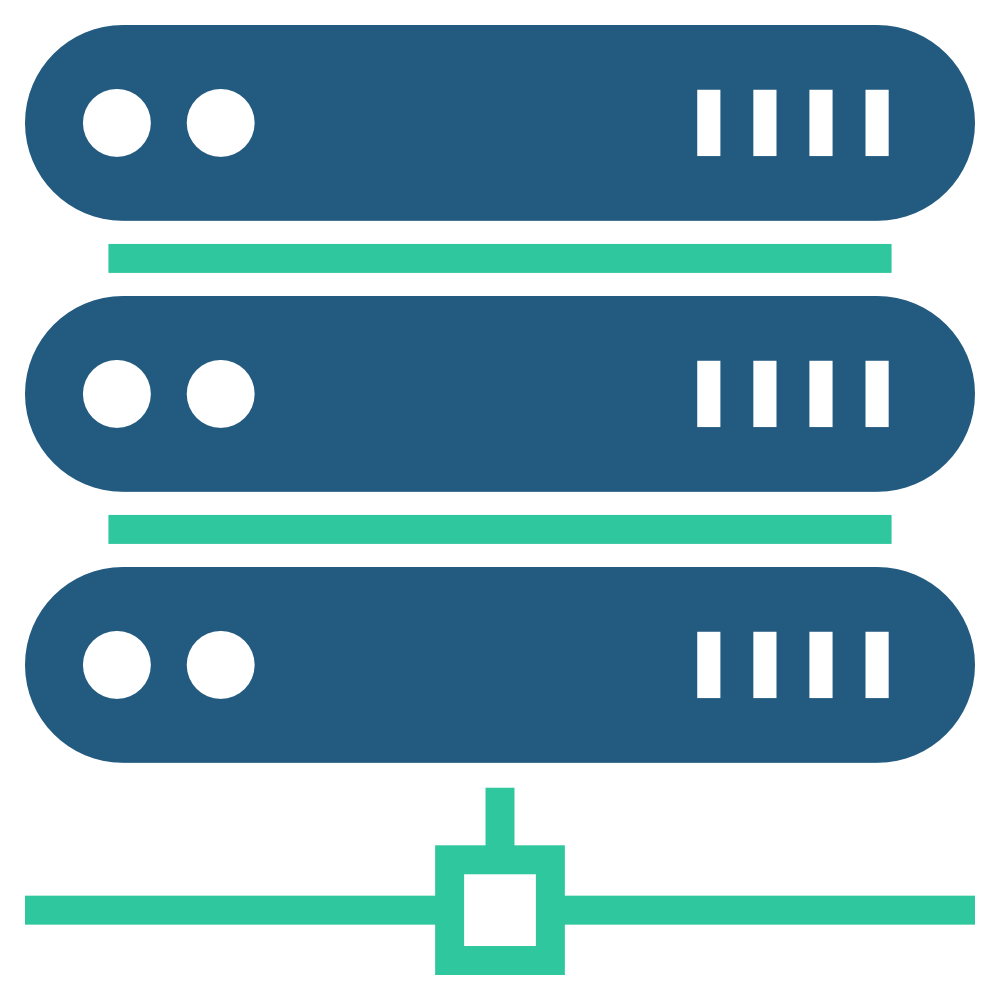
Server-Hosting und -Housing
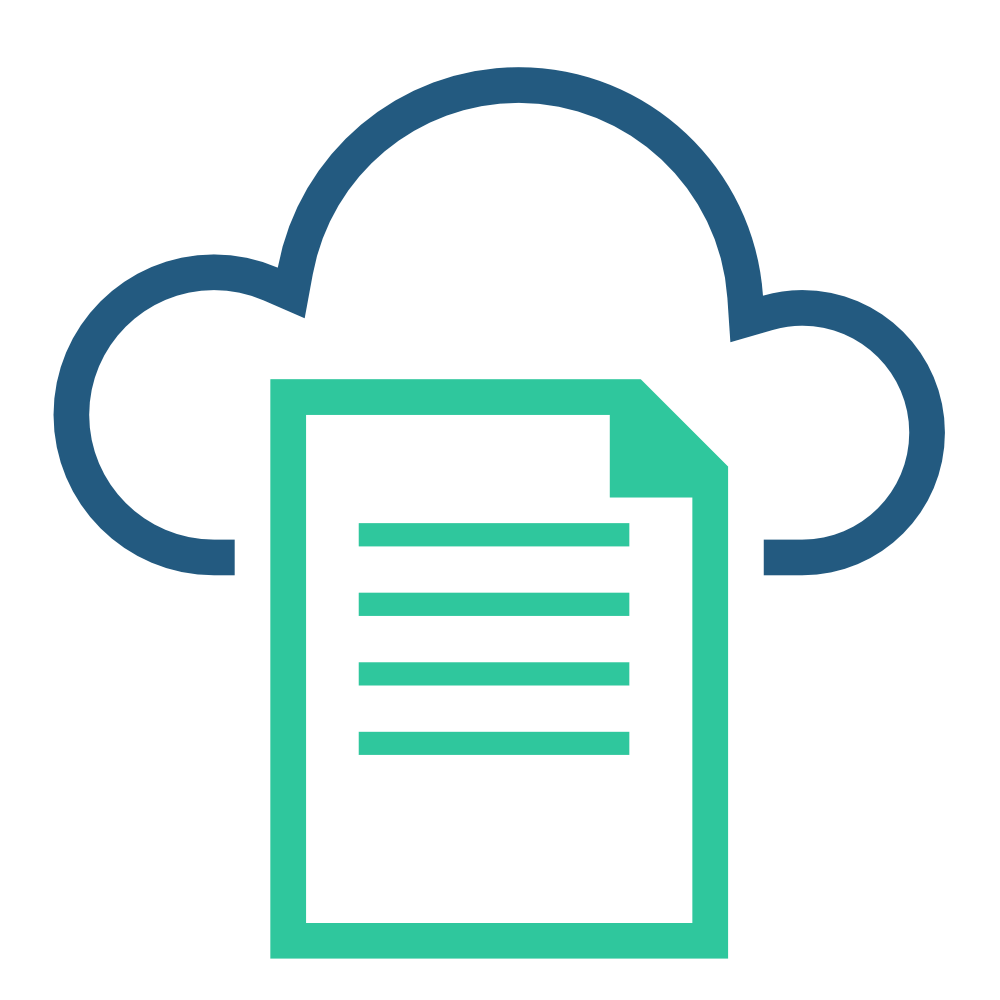
Beratung
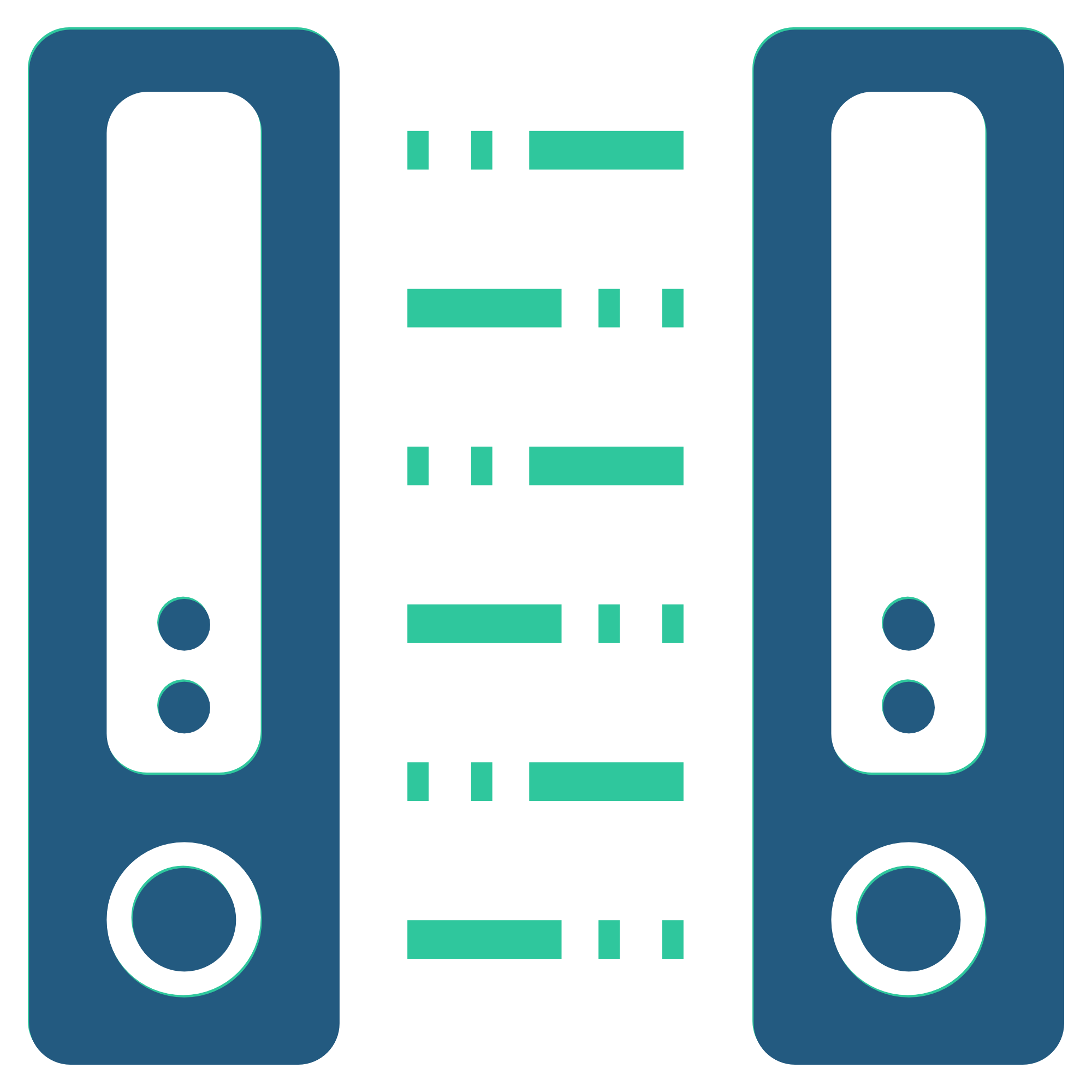
Interconnection
„Der Aufstieg der Hybrid-Cloud: Treibende Nachfrage nach regionalen und Edge-Rechenzentren“
Adriaan Oosthoek, Chairman Portus Data Centers
Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen
Wir betreiben unser Rechenzentrum mit 100% regenerativer Energie aus der Region und atomstromfrei.
Unsere adiabatische Kühlung ist umweltfreundlich, energieeffizient, zuverlässig und spart Kosten.